Das Buch über den Neoliberalismus im Alltag der „ganz normalen Menschen“
Momo - von Michael Ende aus dem Jahr 1973
.
Wie diese Gesellschaft mitsamt den vorherrschenden Wertevorstellungen dargestellt wird, wie Zeitspar-Lobbyisten arbeiten und vor allem welche Parallelen zu unserer Gesellschaft zu ziehen sind, soll anhand einiger Passagen verdeutlicht werden. Zunächst in einem Abschnitt, der die Unterhaltung eines Friseurs mit einem der Vertreter des Zeitsparens darstellt:
‚Keines von beiden‘, sagte der graue Herr, ohne zu lächeln, mit einer seltsam tonlosen, sozusagen aschengrauen Stimme. ‚Ich komme von der Zeit-Spar-Kasse. Ich bin Agent Nr. XYQ/384/b. Wir wissen, daß Sie ein Sparkonto bei uns eröffnen wollen.‘
‚Das ist mir neu‘, erklärte Herr Fusi noch verwirrter. ‚Offengestanden, ich wußte bisher nicht einmal, daß es ein solches Institut überhaupt gibt.
‘‚Nun, jetzt wissen Sie es“, antwortete der Agent knapp. Er blätterte in seinem Notizbüchlein und fuhr fort: ‚Sie sind doch Herr Fusi, der Friseur?‘
‚Ganz recht, der bin ich‘, versetzte Herr Fusi.
‚Dann bin ich an der rechten Stelle‘, meinte der graue Herr und klappte das Büchlein zu. ‚Sie sind Anwärter bei uns.‘
‚Wie das?‘ fragte Herr Fusi, noch immer erstaunt.
‚Sehen Sie, lieber Herr Fusi‘, sagte der Agent, ‚Sie vergeuden Ihr Leben mit Scherengeklapper, Geschwätz und Seifenschaum. Wenn Sie einmal tot sind, wird es sein, als hätte es Sie nie gegeben. Wenn Sie Zeit hätten, das richtige Leben zu führen, wie Sie das wünschen, dann wären Sie ein ganz anderer Mensch. Alles, was Sie also benötigen, ist Zeit. Habe ich recht?‘
‚Darüber habe ich eben nachgedacht‘, murmelte Herr Fusi und fröstelte, denn trotz der geschlossenen Tür wurde es immer kälter.
‚Na, sehen Sie!‘ erwiderte der graue Herr und zog zufrieden an seiner kleinen Zigarre. ‚Aber woher nimmt man Zeit? Man muß sie eben ersparen! Sie, Herr Fusi, vergeuden Ihre Zeit auf ganz verantwortungslose Weise. Ich will es Ihnen durch eine kleine Rechnung beweisen. Eine Minute hat sechzig Sekunden. Und eine Stunde hat sechzig Minuten. Können Sie mir folgen?‘ ‚Gewiß‘, sagte Herr Fusi.
Der Agent Nr. XYQ/384/b begann die Zahlen mit einem grauen Stift auf den Spiegel zu schreiben. ‚Sechzig mal sechzig ist dreitausendsechshundert. Also hat eine Stunde dreitausendsechshundert Sekunden. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden, also dreitausendsechshundert mal vierundzwanzig, das macht sechsundachtzigtausendvierhundert Sekunden pro Tag. Ein Jahr hat aber, wie bekannt, dreihundertfünfundsechzig Tage. Das macht mithin einunddreißigmillionenfünfhundertundsechsunddreißigtausend Sekunden pro Jahr. Oder dreihundertfünfzehnmillionendreihundertundsechzigtausend Sekunden in zehn Jahren. Wie lange, Herr Fusi, schätzen Sie die Dauer Ihres Lebens?‘
‚Nun‘, stotterte Herr Fusi verwirrt, ‚ich hoffe so siebzig, achtzig Jahre alt zu werden, so Gott will.‘‚Gut‘, fuhr der graue Herr fort, „nehmen wir vorsichtshalber einmal nur siebzig Jahre an. Das wäre also dreihundertfünfzehnmillionendreihundertsechzigtausend mal sieben. Das ergibt zweimilliardenzweihundertsiebenmillionenfünfhundertzwanzigtausend Sekunden. Und er schrieb diese Zahl groß an den Spiegel: 2.207.520.000 Sekunden. Dann unterstrich er sie mehrmals und erklärte: ‚Dies also, Herr Fusi, ist das Vermögen, welches Ihnen zur Verfügung steht.‘ Herr Fusi schluckte und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Die Summe machte ihn schwindelig. Er hätte nie gedacht, daß er so reich sei.
‚Ja‘, sagte der Agent nickend und zog wieder an seiner kleinen grauen Zigarre, ‚es ist eine eindrucksvolle Zahl, nicht wahr? Aber nun wollen wir weitergehen. Wie alt sind Sie, Herr Fusi?‘
‚Zweiundvierzig‘, stammelte der und fühlte sich plötzlich schuldbewußt, als habe er eine Unterschlagung begangen. ‚Wie lange schlafen Sie durchschnittlich pro Nacht?‘ forschte der graue Herr weiter.‚Acht Stunden etwa‘, gestand Herr Fusi.Der Agent rechnete blitzgeschwind. Der Stift kreischte über das Spiegelglas, daß sich Herrn Fusi die Haut kräuselte. ‚Zweiundvierzig Jahre – täglich acht Stunden – das macht also bereits vierhunderteinundvierzigmillionenfünfhundertundviertausend. Diese Summe dürfen wir wohl mit gutem Recht als verloren betrachten. […]Nun kommt Ihnen aber auch noch eine gewisse Zeit abhanden durch die Notwendigkeit, sich zu ernähren. Wieviel Zeit benötigen Sie insgesamt für alle Mahlzeiten des Tages?‘‚Ich weiß nicht genau‘, meinte Herr Fusi ängstlich, ‚vielleicht zwei Stunden?‘
‚Das scheint mir zu wenig‘, sagte der Agent, „aber nehmen wir es einmal an, dann ergibt es in zweiundvierzig Jahren den Betrag von hundertzehnmillionendreihundertsechsundsiebzigtausend. Fahren wir fort! Sie leben allein mit Ihrer alten Mutter, wie wir wissen. Täglich widmen Sie der alten Frau eine volle Stunde, das heißt, Sie sitzen bei ihr und sprechen mit ihr, obgleich sie taub ist und sie kaum noch hört.Es ist also hinausgeworfene Zeit: macht fünfundfünfzigmillionen-einhundertachtundachtzigtausend. Ferner haben Sie überflüssigerweise einen Wellensittich, dessen Pflege Sie täglich eine Viertelstunde kostet, das bedeutet umgerechnet dreizehnmillionensiebenhundertsiebenundneunzigtausend.‘
‚Aber …‘, warf Herr Fusi flehend ein.‚Unterbrechen Sie mich nicht!‘ herrschte ihn der Agent an, der immer schneller und schneller rechnete. ‚Da Ihre Mutter ja behindert ist, müssen Sie, Herr Fusi, einen Teil der Hausarbeit selbst machen. Sie müssen einkaufen gehen, Schuhe putzen und dergleichen lästige Dinge mehr. Wie viel Zeit kostet Sie das täglich?‘‚Vielleicht eine Stunde, aber …‘
‚Macht weitere fünfundfünfzigmillioneneinhundertachtundachtzigtausend, die Sie verlieren, Herr Fusi. Wir wissen ferner, daß Sie einmal wöchentlich ins Kino gehen, einmal wöchentlich in einem Gesangverein mitwirken, einen Stammtisch haben, den Sie zweimal in der Woche besuchen, und sich an den übrigen Tagen abends mit Freunden treffen oder manchmal sogar ein Buch lesen. Kurz, Sie schlagen Ihre Zeit mit nutzlosen Dingen tot, und zwar etwa drei Stunden täglich, das macht einhundertfünfundsechzigmillionenfünfhundertvierundsechzigtausend. – Ist Ihnen nicht gut, Herr Fusi?‘
‚Nein‘, antwortete Herr Fusi, ‚entschuldigen Sie bitte …‘“
Genau diese Argumentationslinie findet sich auch im Neoliberalismus wieder: So wird die Forderung formuliert, stets fleißig und angepaßt das Bildungs- und Berufssystem zu durchlaufen. Nur so, heißt es, werde man den Notwendigkeiten einer globalisierten Ökonomie gerecht und nur so könne der gesellschaftliche und persönliche Wohlstand langfristig gesichert werden. Das gesamte Leben soll, wie in Momo dargelegt, der Arbeit und der Funktion im ökonomischen System untergeordnet werden.
In den weiteren Passagen wird gezeigt, wie sehr sich diese Ideologie auch durch weitere Gesellschaftsbereiche der Dystopie zieht:
Über allen Arbeitsplätzen in den großen Fabriken und Bürohäusern hingen deshalb Schilder, auf denen stand: ZEIT IST KOSTBAR – VERLIERE SIE NICHT! oder: ZEIT IST (WIE) GELD – DARUM SPARE!
Ähnliche Schilder hingen auch über den Schreibtischen der Chefs, über den Sesseln der Direktoren, in den Behandlungszimmern der Ärzte, in den Geschäften, Restaurants und Warenhäusern und sogar in den Schulen und Kindergärten. Niemand war davon ausgenommen. Und schließlich hatte auch die große Stadt selbst mehr und mehr ihr Aussehen verändert.
Die alten Viertel wurden abgerissen, und neue Häuser wurden gebaut, bei denen man alles wegließ, was nun für überflüssig galt. Man sparte sich die Mühe, die Häuser so zu bauen, daß sie zu den Menschen paßten, die in ihnen wohnten; denn dann hätte man ja lauter verschiedene Häuser bauen müssen. Es war viel billiger und vor allem zeitsparender, die Häuser alle gleich zu bauen. Im Norden der großen Stadt breiteten sich schon riesige Neubauviertel aus. Dort erhoben sich in endlosen Reihen vielstöckige Mietskasernen, die einander so gleich waren wie ein Ei dem anderen. Und da alle Häuser gleich aussahen, sahen natürlich auch alle Straßen gleich aus. Und diese einförmigen Straßen wuchsen und wuchsen und dehnten sich schon schnurgerade bis zum Horizont – eine Wüste der Ordnung! Und genauso verlief auch das Leben der Menschen, die hier wohnten: Schnurgerade bis zum Horizont! Denn hier war alles genau berechnet und geplant, jeder Zentimeter und jeder Augenblick. Niemand schien zu merken, daß er, indem er Zeit sparte, in Wirklichkeit etwas ganz anderes sparte. Keiner wollte wahrhaben, daß sein Leben immer ärmer, immer gleichförmiger und immer kälter wurde. Deutlich zu fühlen jedoch bekamen es die Kinder, denn auch für sie hatte nun niemand mehr Zeit. Aber Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen. Und je mehr die Menschen daran sparten, desto weniger hatten sie.“
In diesen Absätzen wird der konsequente Umbau der Gesellschaft nach Maßstäben von Effizienz und ökonomischer Logik beschrieben. Eine Kernaussage ist, daß es in einer ökonomistisch-neoliberalen Welt keinen Gesellschaftsbereich gibt, der nicht auf Kosten von Kultur und historisch gewachsenen Strukturen umgebaut wird.Dies etwa trifft auch auf das Architekturparadigma in unserer realen Gesellschaft, vor allem seit den 1950er Jahren zu. Wer nun meint, Platten- und Betonarchitektur beschränke sich auf die 1960er und 1970er Jahre, der möge sich die Glas- und Aluminium-Investorenarchitektur von heute noch einmal genauer anschauen. Auch auf die Kapitalisierung der Wohnungswirtschaft geht Michael Ende beiläufig ein. Wie in der realen Gesellschaft dominieren (mit Ausnahme der Wohngenossenschaften) Renditeerwartungen das System und es wird wenig oder keine Rücksicht auf die Interessen der Bewohner genommen (es sei denn, sie verfügen über sehr viel Geld oder können sich Wohneigentum leisten). Die Verödung der Architektur wird in Momo metaphorisch parallel zur Verödung und Gleichschaltung menschlichen Alltags dargestellt.In den folgenden Passagen wird das wichtige Thema der Kindererziehung in einer neoliberalen Gesellschaft aufgegriffen und es wird am Waisenkind Momo exemplarisch verdeutlicht, was Ziele und Methoden sind, um Kinder zu manipulieren und gleichzuschalten.
[…] Die Puppe sagte nichts und Momo stieß sie an. ‚Guten Tag‘, quäkte die Puppe, ‚ich bin Bibigirl, die vollkommene Puppe.‘ ‚Ja‘, sagte Momo, ‚ich weiß schon. Aber du wolltest dir doch was aussuchen, Bibigirl. Hier hab’ ich zum Beispiel eine schöne rosa Muschel. Gefällt sie dir?‘ ‚Ich gehöre dir‘, antwortete die Puppe, ‚alle beneiden dich um mich.‘ ‚Ja, das hast du schon gesagt‘, meinte Momo. ‚Aber wenn du nichts von meinen Sachen magst, dann können wir vielleicht spielen, ja?‘ ‚Ich möchte noch mehr Sachen haben‘ […] Aber so verhinderte Bibigirl gerade dadurch, daß sie redete, jedes Gespräch. Nach einer Weile überkam Momo ein Gefühl, das sie noch nie zuvor empfunden hatte. Und weil es ihr ganz neu war, dauerte es eine Weile, bis sie begriff, daß es die Langeweile war.“
Die Puppe wiederholt ihre materialistischen Sätze immer wieder, damit das Kind irgendwann tatsächlich an sie glaubt. Durch die Selbstdarstellung als perfekte Puppe soll dem Kind die Phantasie genommen werden. Ist eine Puppe bereits perfekt, gibt es schließlich keine Notwendigkeit mehr, sich andere Personen in diesen Gegenstand hineinzudenken. Mit dem Gefühl der Langeweile schließlich soll das Kind gezwungen werden, sich noch weiter in den Materialismus hineinzusteigern. Hätte es Phantasie, würde ihm schließlich eine Muschel und ein Stein zum Spielen ausreichen und es wäre nicht auf teure Konsumprodukte angewiesen.
‚Paß mal auf, Kleine!‘ Er ging zu seinem Auto und öffnete den Kofferraum. ‚Zuerst einmal‘, sagte er, ‚braucht sie viele Kleider. Hier ist zum Beispiel ein entzückendes Abendkleid.‘ Er zog es hervor und warf es Momo zu. ‚Und hier ist ein Pelzmantel aus echtem Nerz. Und hier ist ein seidener Schlafrock. Und hier ein Tennisdreß. Und ein Skianzug. Und ein Badekostüm. Und ein Reitanzug. Ein Pyjama. Ein Nachthemd. Ein anderes Kleid. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins …‘ […] ‚damit kannst du erst einmal eine Weile spielen, nicht wahr, Kleine? Aber das wird nach ein paar Tagen auch langweilig, meinst du? Nun gut, dann mußt du eben mehr Sachen für deine Puppe haben.‘ Wieder beugte er sich über den Kofferraum und warf Sachen zu Momo herüber. ‚Hier ist zum Beispiel eine richtige kleine Handtasche aus Schlangenleder, mit einem echten kleinen Lippenstift und einem Puderdöschen drin.‘“
[…] ‚Was denn, was denn?‘ sagte der graue Herr und zog die Augenbrauen hoch. […] ‚Ich glaub’‘, sagte sie leise, ‚man kann sie nicht liebhaben.‘
[…] ‚Also Momo – nun höre mir einmal gut zu!‘ begann er schließlich. […] ‚worauf es im Leben ankommt, ist, daß man es zu etwas bringt, daß man was wird, daß man was hat. Wer es weiter bringt, wer mehr wird und mehr hat als die anderen, dem fällt alles übrige ganz von selbst zu: Freundschaft, Liebe, Ehre und so weiter.‘“
Die Unmenschlichkeit der neoliberalen Kindererziehung wird im letzten Absatz entlarvt. Momo hingegen ist eine intuitive Humanistin, die immer zuerst an die Menschen und in Kategorien von Freundschaft denkt und fühlt. Sie spürt, daß beim vorgeschlagenen Erziehungssystem nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern das System der Effizienz (und des Wirtschaftswachstums), welches von den grauen Herren forciert und aufrechterhalten wird. Als der Agent merkt, daß seine Manipulationsversuche nicht anschlagen, gibt er seine Ideologie offen und frei zu. Das schöne Leben finde irgendwann in der Zukunft statt. Zunächst müsse sich das Kind aber an die materialistische Lebens-, Spiel- und Arbeitsweise anpassen. Ein menschliches Gesellschaftssystem wird so auch dem Kind als Köder für die Zukunft vorgehalten. Bis dahin müsse man aber ein ganz anderes, eben stramm effizientes und materialistisches Leben führen.
Diese, wie die anderen dargestellten Passagen aus Momo zeichnen die Dystopie einer vollständig ökonomisierten Gesellschaft, in der das Hauptaugenmerk der Effizienz gilt, die in Form sogenannter „Zeitersparnis“ daherkommt. Mit Ausnahme von Momo haben die Menschen ihre Menschlichkeit fast vollständig verloren und sind zu Automaten geworden, die einem übergeordneten Zweck dienen – den Interessen der Zeitsparkasse und den grauen Herren, die sie ausbeuten und emotional zerstören.
Das Buch Momo beschreibt die konkreten Auswirkungen eines neoliberalen Zeitgeists, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems für die Lebenswirklichkeit der Menschen.
Die Mutter des Erfolgs

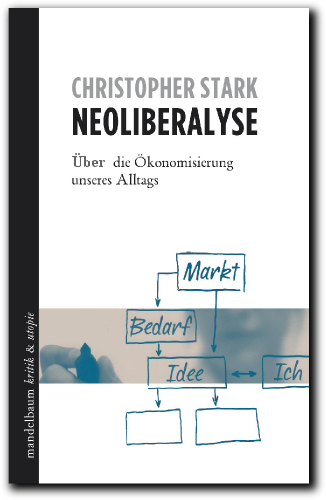




Gast - Tommy
Permalink19. Januar 2011:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSZRom8ucc
Gast - a.nonymous
Permalink29. Mai 2011:
BWLer sind Menschen, die mit Kennzahlen rechnen koennen, aber keine Ahnung haben, was Kennzahlen sind oder wer sie in diese riesigen Nachschlagewerk e geschrieben hat...
Natuerlich kann man auch Lebensqualitaet in Kennzahlen ausdruecken... Wenn es mir schlecht geht oder ich keine Zeit haben, kann ich klar sagen, dass es mich X Euro kostet ein Taxi zu nehmen...
Es ist halt fuer einen BA/MA-Hirngewaschenen Menschen kaum nachvollziehbar , worin der Mehrwert in Dingen jenseits seiner eigenen Lebensweise liegen koennte.
Momo ist in jeder Hinsicht ein extrem ergibiges Werk!
Die Puppe diean sich keinen Spass bereitet, auch deren Zubehoer, zu Hauf hinzuerwerbbar, auch keinen Zugewinn bringt, jedoch das Horten und Sammeln von der Sinnesleere ablenkt.
Zeit und Geld ist eines gemein: wenn man es nutzt ist es am Ende weg... wenn man es nicht nutzt, ist es das auch.
Angepinnt